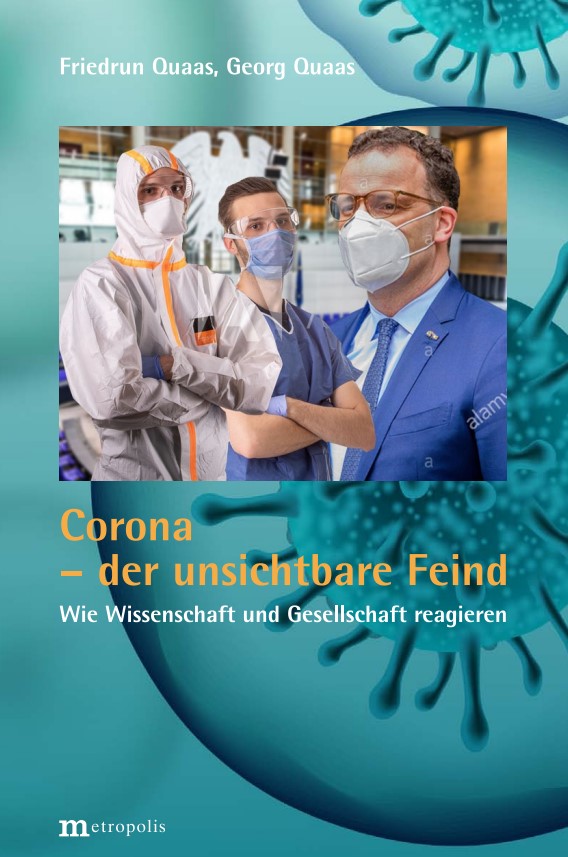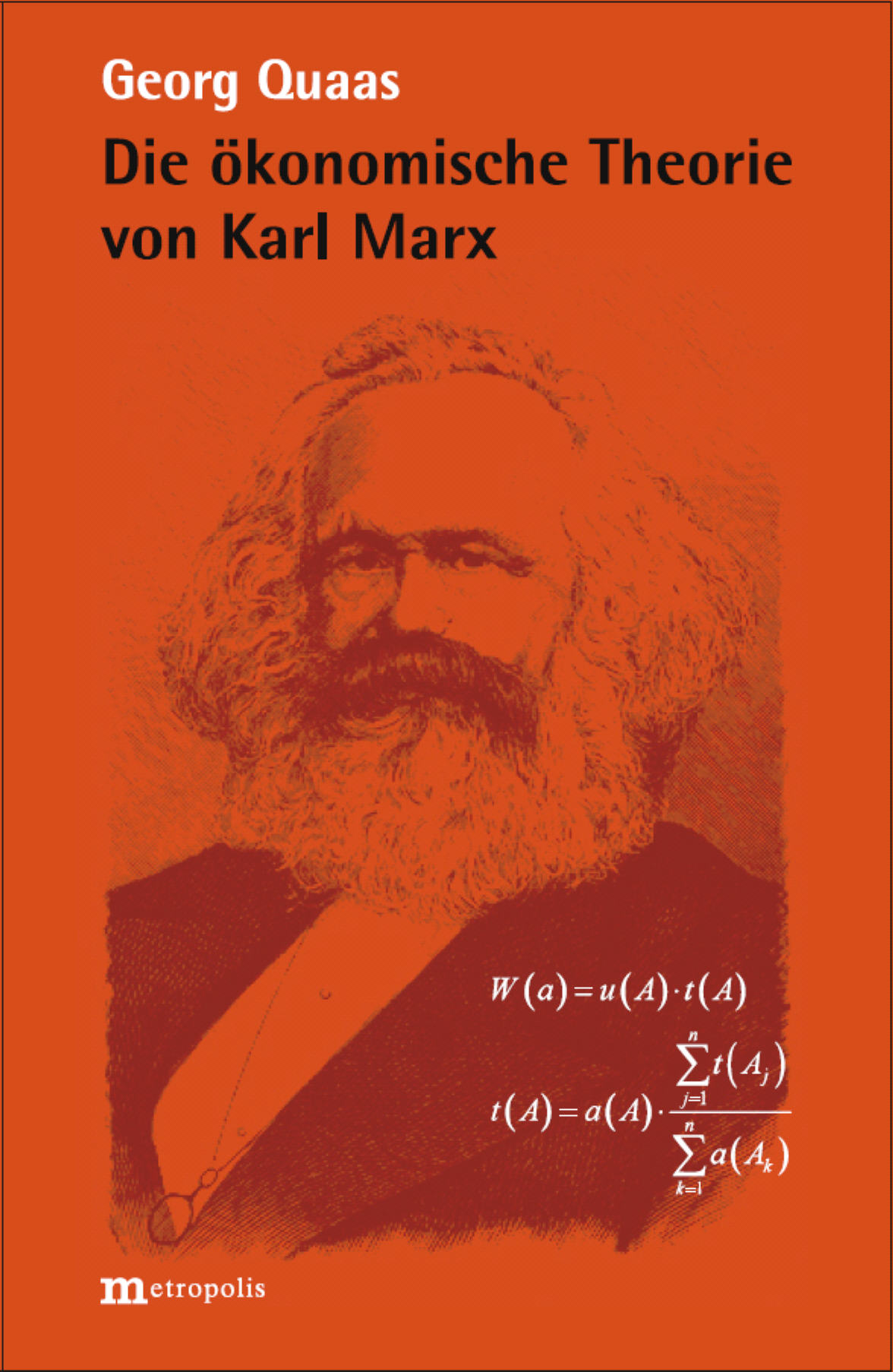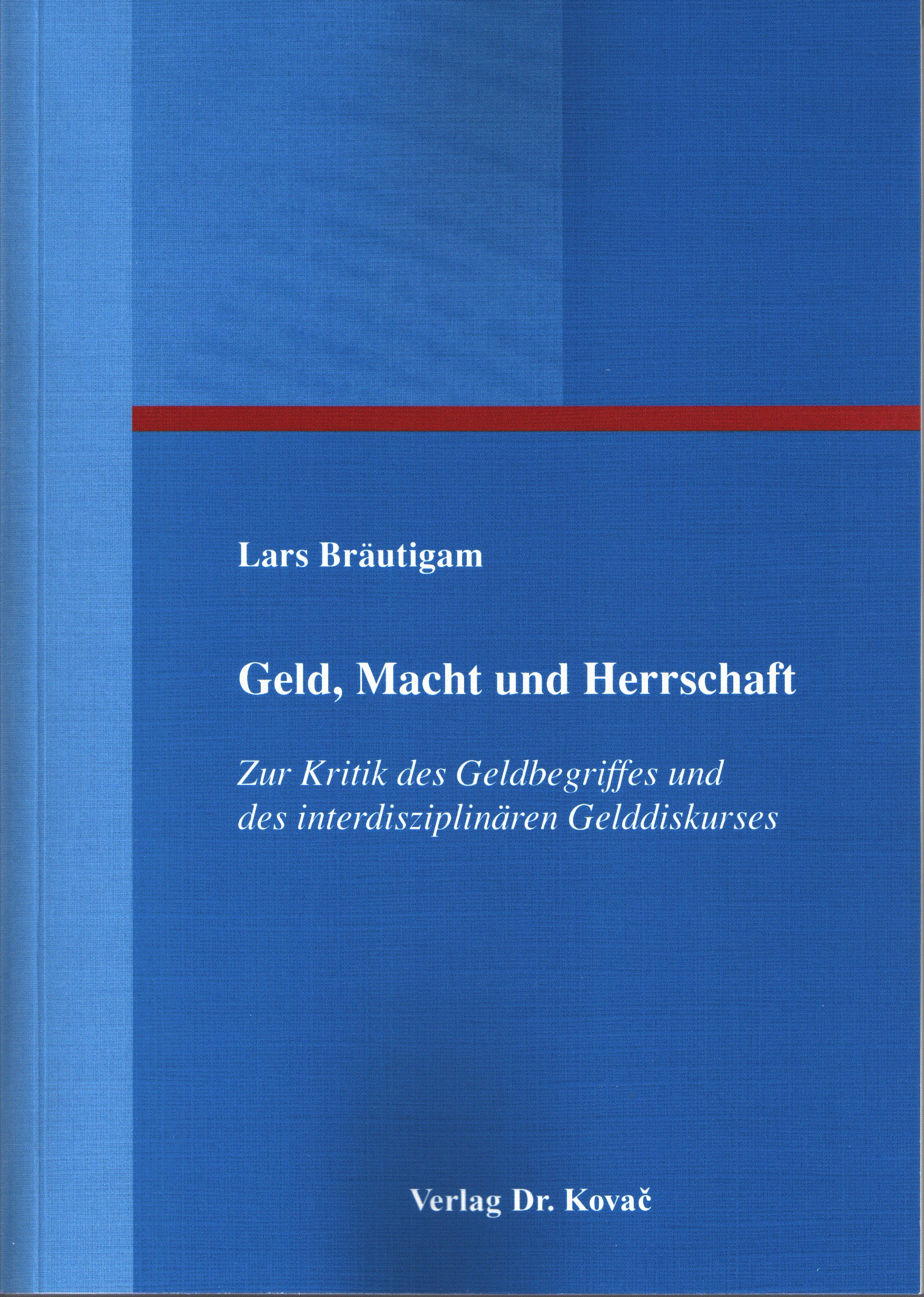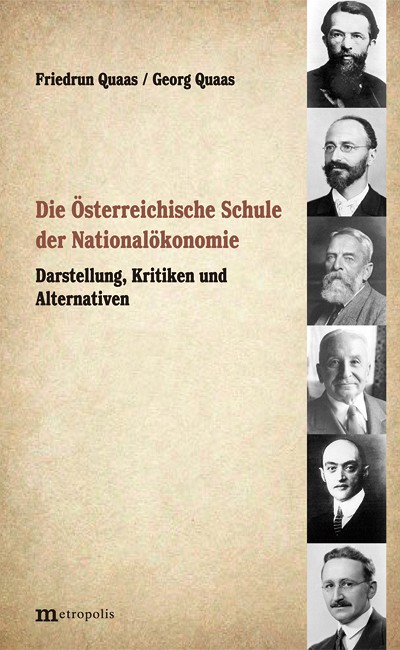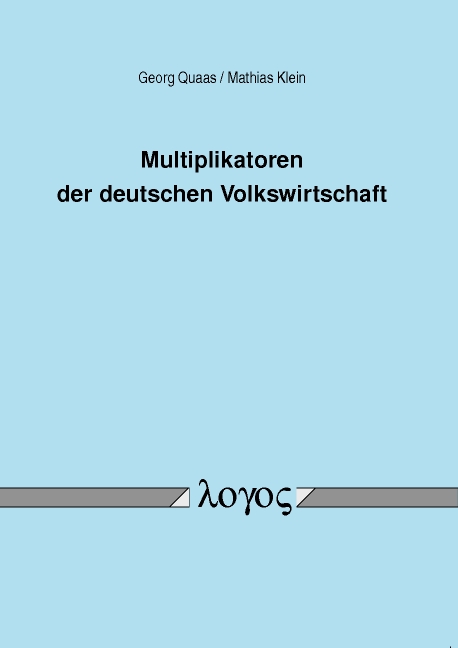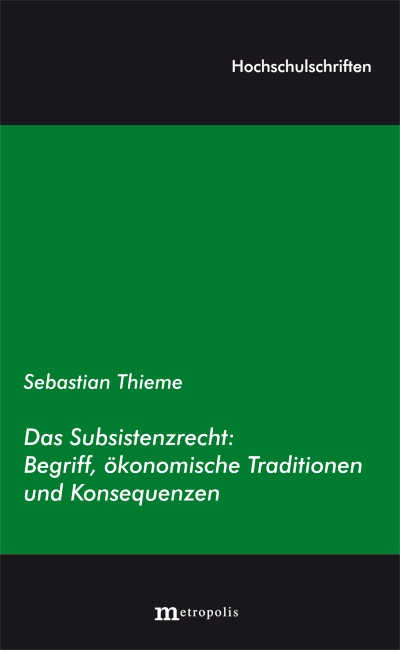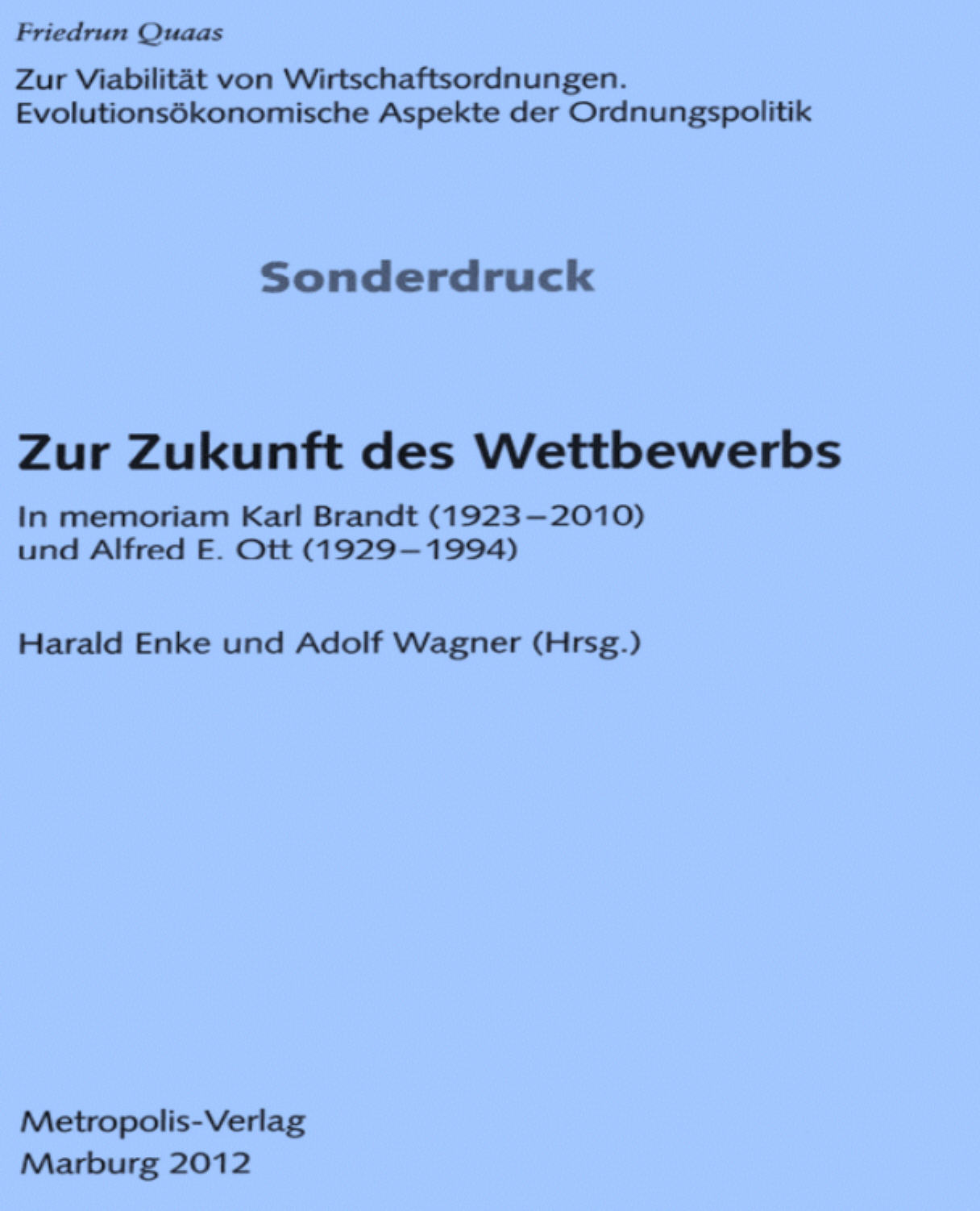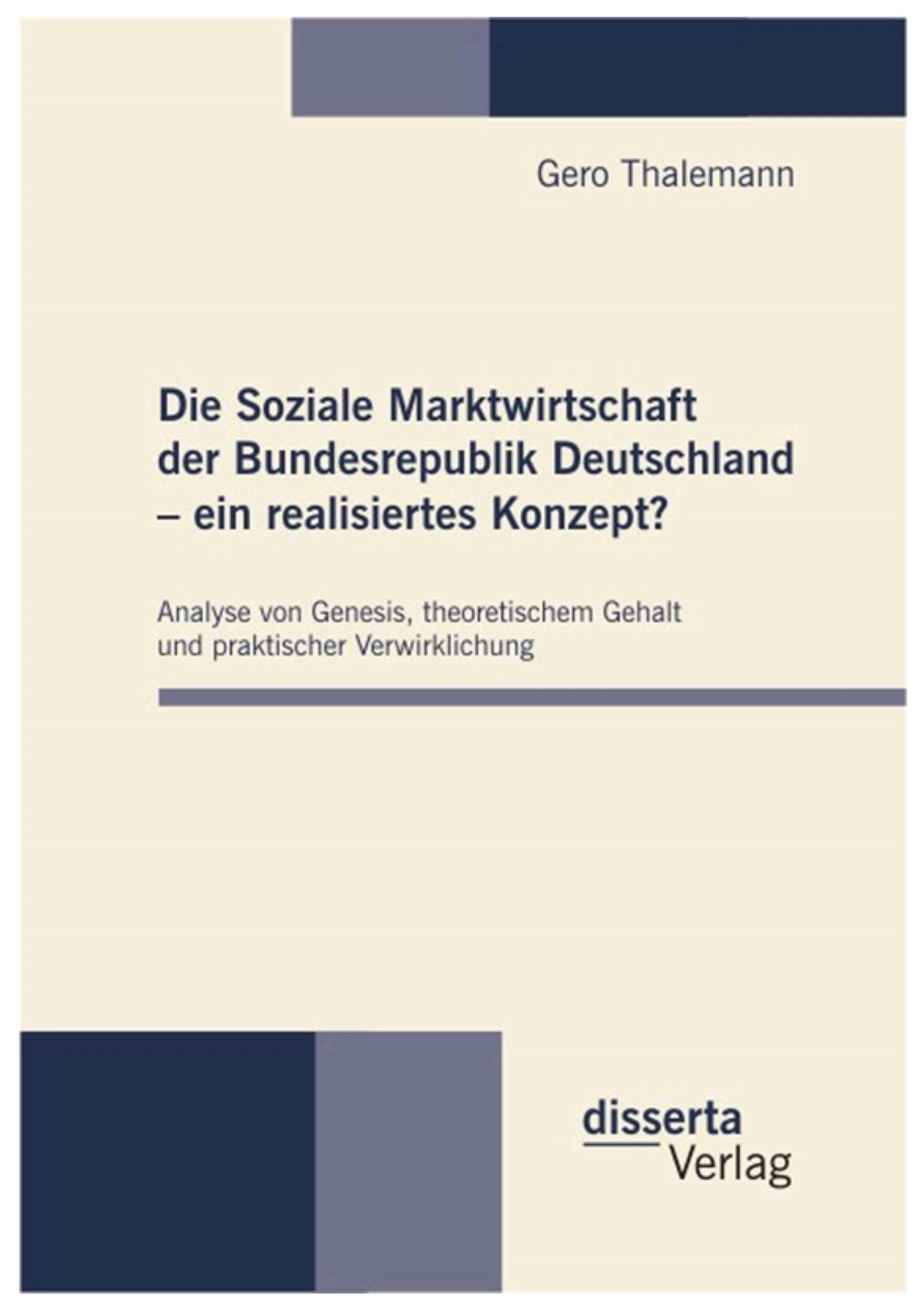|
Friedrun Quaas: John Law (1671-1729). Pionier der Geldtheorie
|

|
|
Der Schotte John Law (1671 - 1729) vertrat eine Geld- und Währungstheorie, die den damals vorherrschenden
rein metallistischen Standpunkt überwindet. Damit erscheint seine Theorie nicht nur aufgeklärt merkantilistisch,
sondern auch aus heutiger Sicht nahezu modern. Dieser Leistung gegenüber greift das weit verbreitete Image John
Laws als Spieler, Abenteurer und leichtfertiger Verursacher des französischen Banken- und Aktiencrashs von 1720
zu kurz. Die Rehabilitierung von John Law wird von der Autorin durch eine umfassende, quellengestützte Analyse
seines bislang nur auszugsweise in deutscher Sprache vorliegenden theoretischen Werks vorangetrieben. Die detaillierte
Darstellung der Praxis des Law'schen System zeigt, in welcher Weise die Umsetzung der Law'schen Theorie an ihre Grenzen
stieß und so den Zusammenbruch dieses frühen Papiergeldsystems im absolutistischen Frankreich nicht zu verhindern vermochte.
Verlag
|
|
Friedrun Quaas, Georg Quaas: Corona - der unsichtbare Feind. Wie Wissenschaft und Gesellschaft reagieren
|
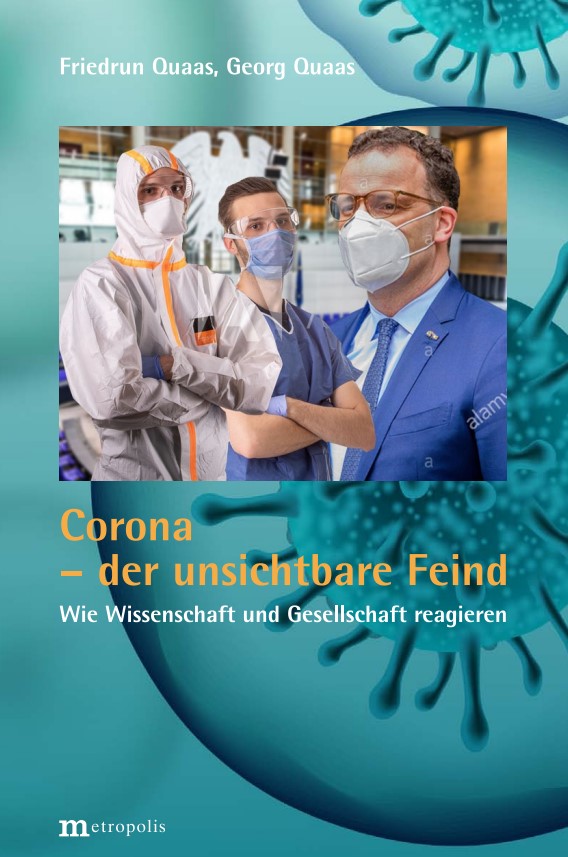
|
|
Das Auftreten des Coronavirus zur Jahreswende 2019/2020 wirkte auf die meisten Menschen wie ein apokalyptisches Ereignis.
Fachleute für Infektionswissenschaften gingen dagegen schon länger davon aus, dass es nur eine Frage der Zeit ist, wann
und wo sich neuartige, ansteckende und tödliche Krankheiten ereignen. Ihnen erscheint die durch das Coronavirus verursachte
Pandemie daher kaum als eine gottgegebene Singularität; aber die Wucht, mit der die Seuche zugeschlagen und die Welt gravierend
verändert hat, konnten auch sie nicht vorhersehen.
Die Autoren des Buches sind Wirtschaftswissenschaftler, die sich seit dem Erscheinen der ersten Berichte über COVID-19-Fälle
in Deutschland der Frage widmen, wie die Wissenschaft ihrer Verantwortung bei der Beratung der Politik gerecht wird. In Deutschland
kommt dem Robert-Koch-Institut (RKI) die Rolle des wichtigsten Politikberaters zu. Es veröffentlicht Dossiers und Kennziffern über
die Seuche sowie täglich nach Örtlichkeiten differenzierte Zahlen über ihren Verlauf. Damit ist es nicht nur das maßgebliche Institut
für Gesundheitspolitik, sondern auch der Datenproduzent fü die "Fachöffentlichkeit". Daneben gibt es noch andere namhafte
Experten, die hin und wieder ihre Analysen, Kommentare und Vorschläge äußern. Das Buch erhält eine zutiefst persönliche Note durch
den Kampf der beiden Autoren, das RKI und - als dieses nicht reagiert - eine breitere wissenschaftliche Öffentlichkeit davon zu überzeugen,
dass und wie die Reproduktionszahl richtig, das heißt im Rahmen der einschlägigen epidemiologischen Modelle, zu berechnen ist.
Sie sind überzeugt davon, dass es sich dabei um eine Kennziffer handelt, die der Politik zeitnah, präzise und mit einer klaren Orientierung
Auskunft über die sich schnell wandelnde Situationen im Seuchengeschehen geben kann. Das nur machtpolitisch erklärbare Verhalten des RKI,
einiger Redaktionen, Vertreter der Medien und der Politik veranlasst die Autoren, über verschiedene gesellschafts- und wissenschaftspolitischen
Aspekte der Corona-Krise nachzudenken. Dadurch wird das Buch zu einem Spiegel für den selbst verschuldeten Prestigeverlust der Wissenschaft
in der ersten großen Welle der Pandemie.
Verlag
|
|
Klaus Müller, Georg Quaas: Kontroversen über den Arbeitswert
|

|
|
Klaus Müller (geb. 1944) diskutiert mit Georg Quaas (geb. 1951) über die Werttheorie von Karl Marx. Lässt sich eine einfache Lösung
des Transformationsproblems von Werten in Preise finden? Können Werte in Arbeitszeiteinheiten gemessen werden? Gibt es Schnittstellen
zwischen der Marxschen Theorie und der Mainstream-Ökonomik? Diese und ähnliche Fragen sind im Laufe von zwei Jahren per E-Mail mit
schonungsloser Härte der Argumentation diskutiert worden, ohne jemals den Respekt vor dem anderen zu verlieren. Das Ergebnis ist ein
tieferes Verständnis der jeweils anderen Position, aber keine Revision der eigenen. Letztlich bleibt es dem Leser überlassen, welche
der vertretenen Positionen überzeugender ist.
Verlag
|
|
Georg Quaas: Relationale Geldtheorie
|

|
|
Was auch immer von Experten und Laien als Geld definiert und angesehen wird: Es repräsentiert ökonomische Werte.
Und nur solange das der Fall ist, wird es von den Akteuren einer Volkswirtschaft als Tausch- und Zahlungsmittel
akzeptiert. Der Mechanismus, der die Stabilität der repräsentierten Werte in einem zweistufigen Geldsystem herstellt
und garantiert, besteht darin, Zentralbankgeld nur gegen ausreichend hohe Sicherheiten in Umlauf zu setzen. Nicht allein
das Drucken schwer kopierbarer Banknoten erzeugt wertstabiles Geld, sondern vor allem der Tausch dieser Noten gegen
hochwertige und marktgängige Eigentumstitel. Erstaunlich ist, dass diese triviale Tatsache von den meisten Geldtheorien
ignoriert wird.
Nach einer entsprechenden Darstellung der Geldschöpfung setzt sich das Buch sowohl mit prominenten als auch weniger
prominenten Geldtheorien auseinander und zeigt, dass sie das moderne Geldsystem nur lückenhaft und verzerrt darstellen.
Dagegen kann sich eine relationale Geldtheorie, die Geld als ein verdinglichtes ökonomisches Verhältnis betrachtet,
mühelos durchsetzen. Sie liefert außerdem die theoretische Grundlage, um die Gefahr hoher bei der Bundesbank aufgelaufener
Targetsalden als ein Scheinproblem zu entlarven.
Die Erläuterung des Unterschiedes zwischen Sparen von Geld und dem, was der Volkswirt darunter versteht, bereitet den
Boden, um am Beispiel Griechenlands zu zeigen, dass ein auf die Staatsschuld fokussiertes Hilfsprogramm nicht in der
Lage ist, eine Volkswirtschaft aus der Krise zu führen.
Verlag
|
|
Frank Fehlberg: Arbeitswert und Nachfrage.
Die Sozialökonomik von Karl Rodbertus zur Einführung
|

|
|
Karl Rodbertus (1805-1875) war einst für sein "Gesetz der fallenden Lohnquote" in "sich selbst überlassenen"
Privatkapitalwirtschaften bekannt. Er gilt überdies als Begründer des preußischen Staatssozialismus. Die
sozialwissenschaftliche Analytik seiner Gedankenwelt bietet jedoch wesentlich mehr - und sie gewinnt wieder
an Aktualität. Der vorliegende Band will eine systematische Einführung in das Gesamtwerk geben und zugleich
Ausblicke in die Rezeptionsgeschichte eröffnen. Karl Marx schrieb in seinem "Kapital", Rodbertus habe "das
Wesen der kapitalistischen Produktion durchschaut". Ferdinand Lassalle hielt ihn gar für den "größten
deutschen Nationalökonomen" seiner Zeit. Für einen Vordenker der Neoklassik, John B. Clark, war die Verknüpfung
von Verteilungs- und Krisentheorie, die Rodbertus entwickelt hatte, noch von "großem wissenschaftlichen Interesse".
Eugen Böhm-Bawerk gestand Rodbertus einen sicheren Stand in der Theoriegeschichte zu und hielt ihn für den
"liebenswürdigsten Sozialisten". Joseph Schumpeter verortete seine wirkmächtige "Gesamtauffassung" zwischen
David Ricardo und Marx, außerdem habe er Grundbegriffe wie denjenigen der ökonomischen Renten geprägt.
Rodbertus begriff moderne Ökonomie als "Gesellschaftswirtschaft" und diese als überindividuelles Wirtschaftssubjekt.
Er stützte sich in seiner Renten- und Verteilungstheorie auf Konzepte wie die "relative Armut" und die gesamtwirtschaftliche
"wirksame Nachfrage". Er sprach von Geld nicht als Ware, sondern als "Kommunikationsmittel" der Produktwert- und
Produktverteilung und befürwortete kreditfinanzierte Konjunkturprogramme. Eine effektive Regulierung der Börsen
versprach er sich von den "vereinigten Staaten Europas". Als Landwirt hob er die natürlichen Grundlagen der
Produktion hervor, vor deren Vereinnahmung durch das Privatkapital er nachdrücklich warnte. Seine Spuren hinterließ
Rodbertus im Sozialstaatsgedanken, in der Sozialdemokratie, im Sozialkonservatismus und in all jenen heute getrennt
betriebenen Sozialwissenschaften, die er in einer "Gesellschaftswissenschaft" der Sozioökonomie zusammengefasst sehen wollte.
Verlag
|
|
Georg Quaas: Die ökonomische Theorie von Karl Marx
|
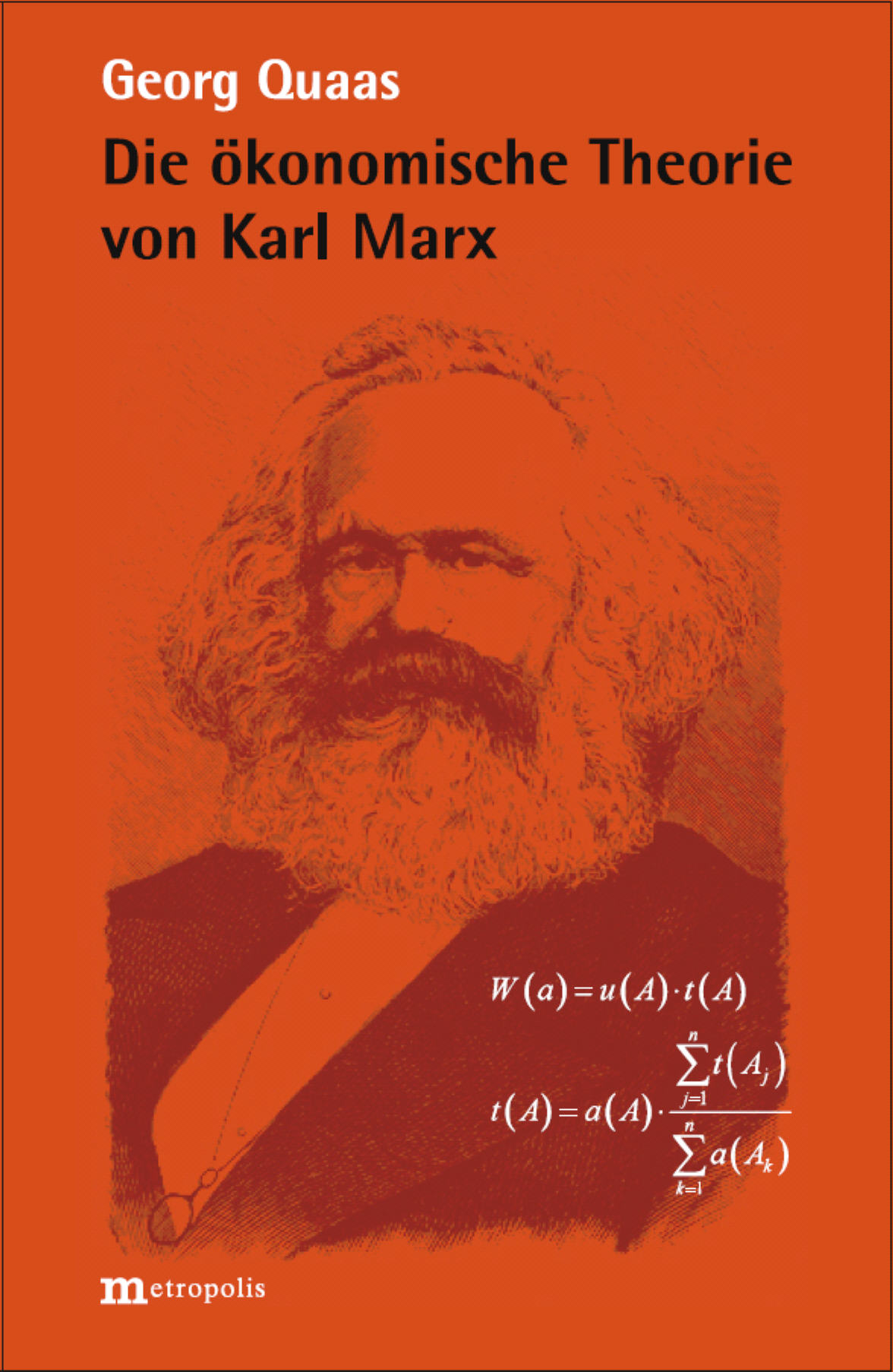
|
|
Die Arbeitswertlehre von Karl Marx führt den Wert auf die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit zurück,
die erforderlich ist, um Waren unter den gesellschaftlich-normalen Produktionsbedingungen herzustellen.
Doch dieser Wert muss, um den Warentausch zu ermöglichen, als Tauschwert dargestellt werden oder im Preis erscheinen.
Damit kommt ein weiteres Verhältnis ins Spiel, das oftmals übersehen wird: Das Verhältnis von Angebot und Nachfrage.
Nach Marx modifiziert dieses Verhältnis die Erscheinung des Wertes im Preis. Als zusammenfassender Ausdruck wird
hier der Begriff des auf dem Markt geltenden Werts einer Ware geprägt und dem Konzept einer monetären Werttheorie
entgegengestellt. Eine textgetreue und mit den exakten Instrumenten der Mathematik versehene Rekonstruktion der
ökonomischen Theorie von Karl Marx ermöglicht es, im Kapital eine Theorie der Entwicklung des Geldes und darüber
hinaus einen klassischen Ansatz der Preistheorie zu identifizieren. Die Darstellung grundlegender Gesetze der Werttheorie
erlaubt die Ableitung von Phänomenen der Konkurrenz, die in der modernen Ökonomik, aber auch bei Marx, einfach
vorausgesetzt werden. Im kapitalistischen Produktionsprozess erfährt die Werttheorie eine Konkretisierung, indem
nicht nur die Wertbildung, sondern auch die Wertübertragung berücksichtigt wird. Die verbreitete Auffassung, dass
Dienstleistungen keine Werte erzeugen, sondern konsumieren, wird mit zahlreichen Argumenten widerlegt. Erst durch
das Einbinden der Dienstleistungen in den Prozess der Wertschöpfung kann die werttheoretische Grundlage der modernen
Input-Output-Analyse (IOA) sichtbar gemacht werden. Eine Anwendung der IOA auf die Schemata der einfachen und
erweiterten Reproduktion erzeugt eine Reihe von neuen Einsichten und Problemen, die ohne einen entwickelten
mathematischen Apparat offenbar nicht erkennbar sind. Abschließend wird gezeigt, dass Ontologie, Entwicklungstheorie
und Mathematik flexibel zusammenwirken, um die Werttheorie auf einem zeitgemäßen Niveau darzustellen.
Verlag
|
|
Lars Bräutigam: Geld, Macht und Herrschaft.
Zur Kritik
des Geldbegriffes und des interdisziplinären Gelddiskurses
|
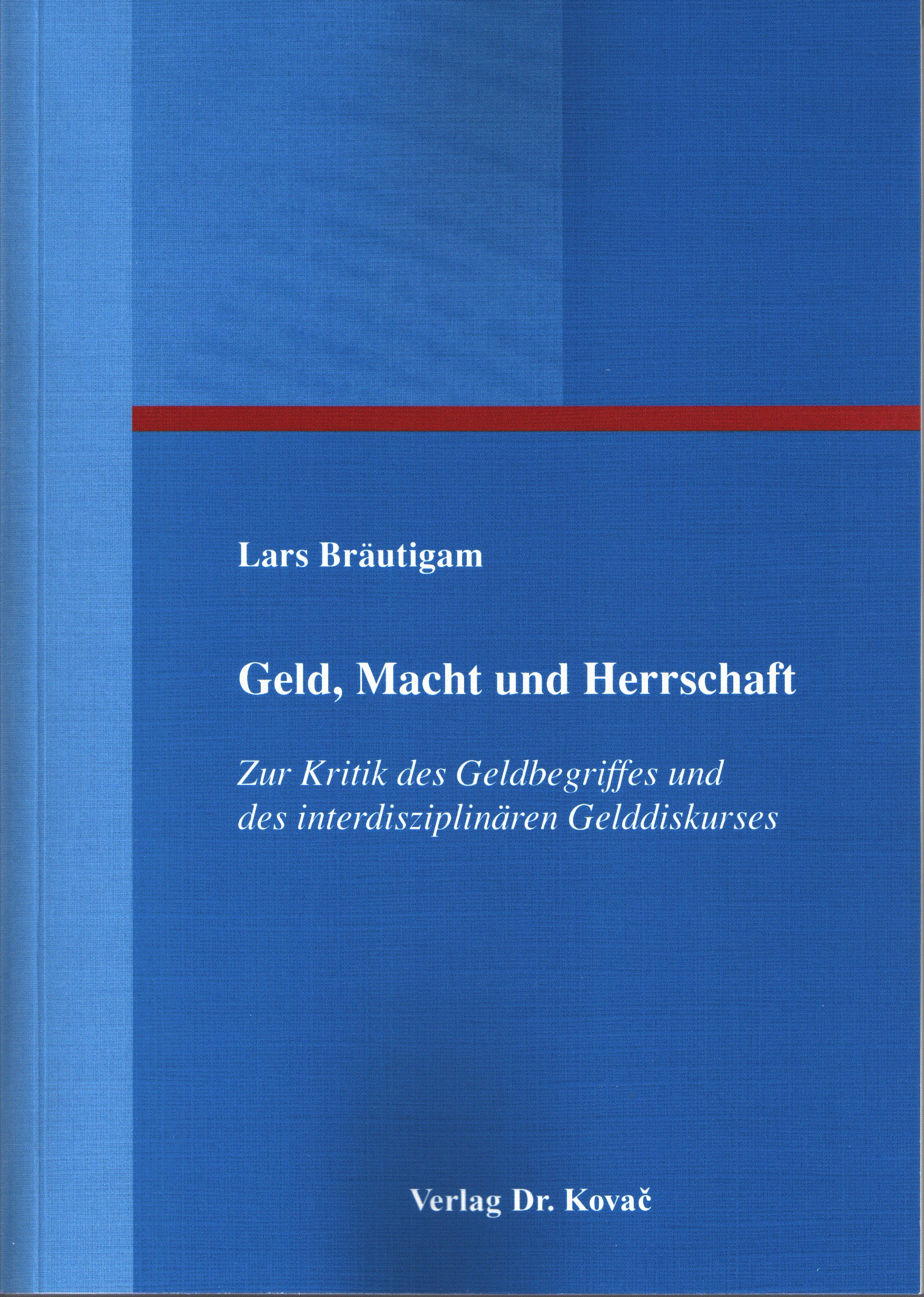
|
|
"Geld, Macht und Herrschaft" ist eine interdisziplinäre Untersuchung über
den theoretischen Umgang mit Geld und seiner funktionalen Abgrenzung. Es
werden theoretische Grundlagen für eine vergleichende interkulturelle
Geldbetrachtung anhand einer Kritik des gegenwärtigen Gelddiskurses
erarbeitet. Zugleich bietet das Buch eine streitbare Theorie über die
prinzipiellen Gemeinsamkeiten modernen und primitiven Geldes, die sich
der Tendenz entgegenstellt, Geld nur in den Formen anzuerkennen, die
es in entwickelten Gesellschaften annimmt.
Verlag
|
|
Forschungsseminar Poltik und Wirtschaft: Booms, Busts und blinde Flecken
|

|
|
In Zeiten sozialer und ökonomischer Unsicherheit befindet sich die Politik in einem Erklärungs- und Legitimationszwang.
Die Frage nach dem Fundament gesellschaftspolitischer Entscheidungen muss dringender denn je beantwortet werden. In dieser
Situation bietet sich die New Austrian School of Economics (NASE) als theoretische Alternative zum Mainstream der Ökonomik an.
Ihr eigener Entwurf richtet sich vor allem gegen eine lockere Geldpolitik. Im Buch werden die Geschichte, der theoretische Kern
und das Umfeld der Österreichischen Schule der Nationalökonomie analysiert. F. Quaas weist nach, dass es eine durchgängige
Kohärenz innerhalb dieser Schule zu keiner Zeit gegeben hat. F. Arglist diskutiert die Hayek sche Gerechtigkeitskonzeption
unter der Fragestellung, ob sie heutigen Ansprüchen gerecht wird. Am Beispiel der Grundeinkommens-Diskussion zeigt S. Thieme
auf, dass ein wichtiger Zugang zur sozialen Frage verloren geht, wenn die individuelle Selbsterhaltung nicht thematisiert wird.
Dem Postulat der Neutralität des Geldes und der daraus resultierenden Dichotomie von Finanz- und Realwirtschaft innerhalb der
Mainstream-Theorie setzt K. Müller den Entwurf einer in Ansätzen bei Marx und Keynes vorhandenen monetären Produktionswirtschaft
entgegen als eine dem kapitalistisch-marktwirtschaftlichen System passendere Charakteristik. Der theoretische Beitrag Schumpeters
besteht bekanntlich in der Darstellung von Innovationen als Ursache für wirtschaftliche Schwankungen, aber auch für Krisen. R. Scholz
verortet ihn innerhalb der verschiedenen Konjunkturtheorien und erinnert an eine seiner modelltheoretischen Umsetzungen. L. Bräutigam
zieht eine Parallele zwischen modernen Erklärungen der Eurokrise und dem theoretischen Konzept von Tugan-Baranowsky. G. Quaas
rekonstruiert die Hayek sche Idee einer Umstrukturierung der Volkswirtschaft aufgrund freiwilligen Sparens mit Hilfe eines
Mengenmodells und weist nach, dass damit eine für alle Volkswirtschaften gültige Viabilitätsbedingung verletzt wird. Unter Verwendung
von zeitreihenanalytischen Methoden untersucht R. Köster die besonders von der NASE proklamierte empirische Relevanz der Ersparnis
als Determinante für die Investitionen.
Verlag
|
|
Friedrun Quaas, Georg Quaas: Die Österreichische
Schule der Nationalökonomie
|
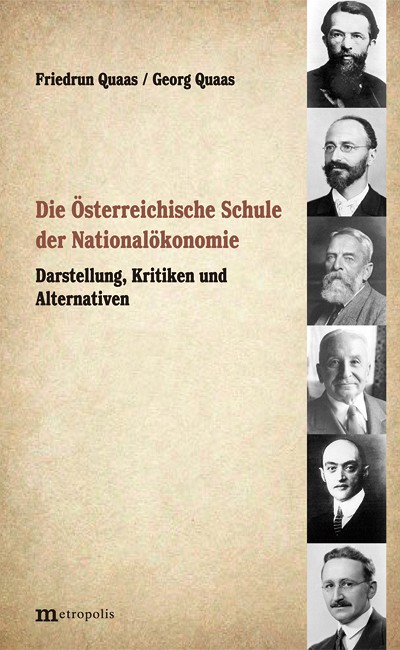
|
|
Die Österreichische Schule der Nationalökonomie erlebt gegenwärtig ein Comeback.
Ihre traditionsreiche Vergangenheit wird durch die letzte Generation, die New Austrians,
in den Dienst aktueller Theoriedebatten gestellt, die vor dem Hintergrund der jüngsten
Weltwirtschaftskrise mit neuer Schärfe geführt werden. Besonderes Vertrauen wird dabei
in die Erklärungsleistung der monetären Überinvestitionstheorie von Friedrich A. von Hayek
gesetzt. Doch ist dieses Vertrauen gerechtfertigt? Und existiert überhaupt eine homogene
"österreichische" Theorie als Garant für eine bessere wirtschaftspolitische Praxis?
Die Autoren behandeln diese Fragen in vier Kapiteln unter verschiedenen Gesichtspunkten.
Friedrun Quaas zeichnet im Kapitel I die Entwicklung der Österreichischen Schule
über ihre verschiedenen Generationen nach. Das dabei entstehende Bild einer großen
Heterogenität zeigt die Bruchstellen zwischen den einzelnen Vertretern der Schule auf.
Selbst grundlegende Positionen der österreichischen Theorie sind im Laufe der Zeit
einer fortschreitenden Bastardierung unterworfen worden.
Im Kapitel II wird Hayeks Überinvestitionstheorie theoriehistorisch eingeordnet.
Dieser zu keiner Zeit alternativlose Ansatz wurde im Zuge wissenschaftlicher
Auseinandersetzungen durch stichhaltige Kritiken schwer beschädigt und ist in der
traditionellen Form zurückzuweisen.
Georg Quaas analysiert im Kapitel III den Kern der Überinvestitionstheorie,
das Hayeksche Dreieck. Im Rahmen einer einfachen algebraischen Darstellung des Dreiecks
kann nicht nur die ältere Kritik rekonstruiert, sondern auch gezeigt werden, dass
wichtige Unterscheidungen und Thesen, auf die sich die aktuellen Empfehlungen der
Austrians stützen, logische Widersprüche enthalten. Empirisch lassen sich zentrale
Elemente der Überinvestitionstheorie anhand der Daten für die deutsche Volkswirtschaft
falsifizieren.
In Kapitel IV wird eine Alternative zum Hayekschen Dreieck entwickelt und in den
grundlegenden Eigenschaften dargestellt. Dabei handelt es sich um einen algebraischen
Ansatz für eine kapitalgestützte Makroökonomik mit Rückgriff auf das Mengenmodell
der Neoricardianischen Schule. Durch theoretische Einbettung des Modells in eine
marktwirtschaftliche Umgebung und seine Dynamisierung ist es möglich, einen
konjunkturähnlichen Verlauf der Entwicklung einer Volkswirtschaft zu simulieren.
Damit darf Hayeks generelle Kritik an nicht-monetären Konjunkturtheorien ebenfalls
als widerlegt betrachtet werden.
Verlag
|
|
Georg Quaas / Mathias Klein: Multiplikatoren der deutschen Volkswirtschaft
|
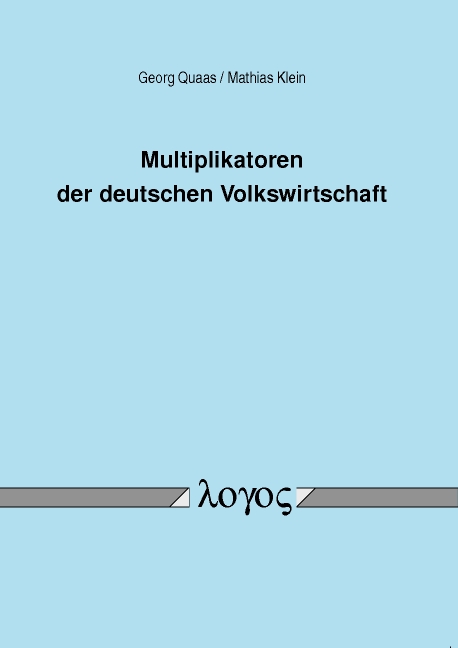
|
|
Wirtschaftspolitische Maßnahmen, zu denen Politiker in Zeiten der Stagnation greifen, um sich die Gunst ihrer Wähler zu sichern, reflektieren
vor allem parteipolitische Interessen und Kompromisse und stellen eher zufällig volkswirtschaftlich sinnvolle Maßnahmen dar. Um auf die
makroökonomische Steuerung Einfluss nehmen zu können, ist es wichtig, die Wirkungen wirtschaftspolitischer Maßnahmen abschätzen und
wissenschaftlich fundierte Vorschläge machen zu können. Doch dazu sind die meisten Ökonomen in Ermangelung entsprechend umfänglicher
Modelle selten in der Lage. Wie sich jedoch gezeigt hat, sind solche Modelle auf dem Gebiet der Politikberatung ein Instrumentarium,
das durch den modernen Trend zu immer spezielleren Zeitreihenanalysetechniken nur bedingt ersetzt werden kann.
Die vorliegende Studie analysiert die volkswirtschaftlichen Effekte einer Reihe von wirtschaftspolitischen Maßnahmen und sogenannter
exogener Schocks mittels einer öffentlich verfügbaren Version des Konjunkturmodells des Rheinisch-Westfälischen Instituts für
Wirtschaftsforschung (KOMO) und eines aktuelleren ökonometrischen Modells mit der Bezeichnung Econometric Model of the German Economy
(EMGE), das sich seit 2008 in der Erprobungsphase befindet (www.forschungsseinar.de). Im Ergebnis können sowohl die Größenordnungen als
auch der Verlauf der jeweils erzielbaren Wirkungen besser abgeschätzt werden.
Verlag
|
|
Sebastian Thieme: Das Subsistenzrecht: Begriff, ökonomische Traditionen und Konsequenzen
|
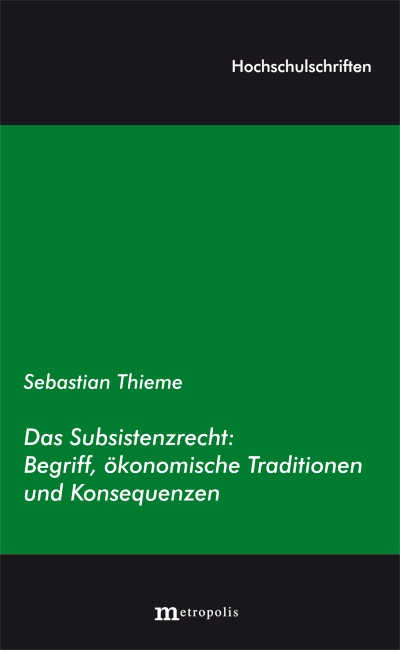
|
|
"Subsistenz" steht für das Bestehen aus sich selbst heraus und zielt letztlich auf die menschliche Selbsterhaltung ab. Die Arbeit greift diesen
Begriff auf und versucht in einer ersten Annäherung folgende Fragen zu erwägen: Welche Bedeutung besitzt das Subsistieren für ökonomisch-soziale
Verhältnisse? Wie wurde die Subsistenz in der Wissenschaft thematisiert? Spielte die Selbsterhaltung überhaupt eine Rolle? Wie sind die
wissenschaftlichen Lösungen für soziale Probleme unter dem Blickwinkel der Subsistenz zu bewerten? Welche Widersprüche treten zwischen dem
Anspruch auf Subsistenz und den wissenschaftlichen Ansätzen zu Tage? An die Beschäftigung mit diesen Fragen schließt sich eine Analyse
verschiedener Ethik-Konzepte an, die eine Antwort darauf geben soll, wie sich ein Subsistenzrecht als überpositives Moralprinzip rechtfertigen
lässt. Vor diesem Hintergrund werden dann denkbare Konsequenzen reflektiert. Auf der Theorie-Ebene umfasst dies vor allem die Beschäftigung mit
der Modellierung des Arbeitsmarktes, der Idee eines Rechts auf Arbeit, dem Konzept des "bedingungslosen" Grundeinkommens, dem Mindestlohn und dem
Subsidiaritätsprinzip. Aber es werden auch Fragen mit einem stärkeren Praxisbezug erörtert, z.B.: Sind Landbesetzungen - wie in Brasilien - ethisch
legitim? Wie sind die "Hartz-Reformen" unter subsistenzethischen Gesichtspunkten zu bewerten? Wird in der BRD noch eine Soziale Marktwirtschaft betrieben?
Verlag
|
|
Friedrun Quaas: Zur Viabilität von Wirtschaftsordnungen. Evolutionsökonomische Aspekte der Ordnungspolitik
|
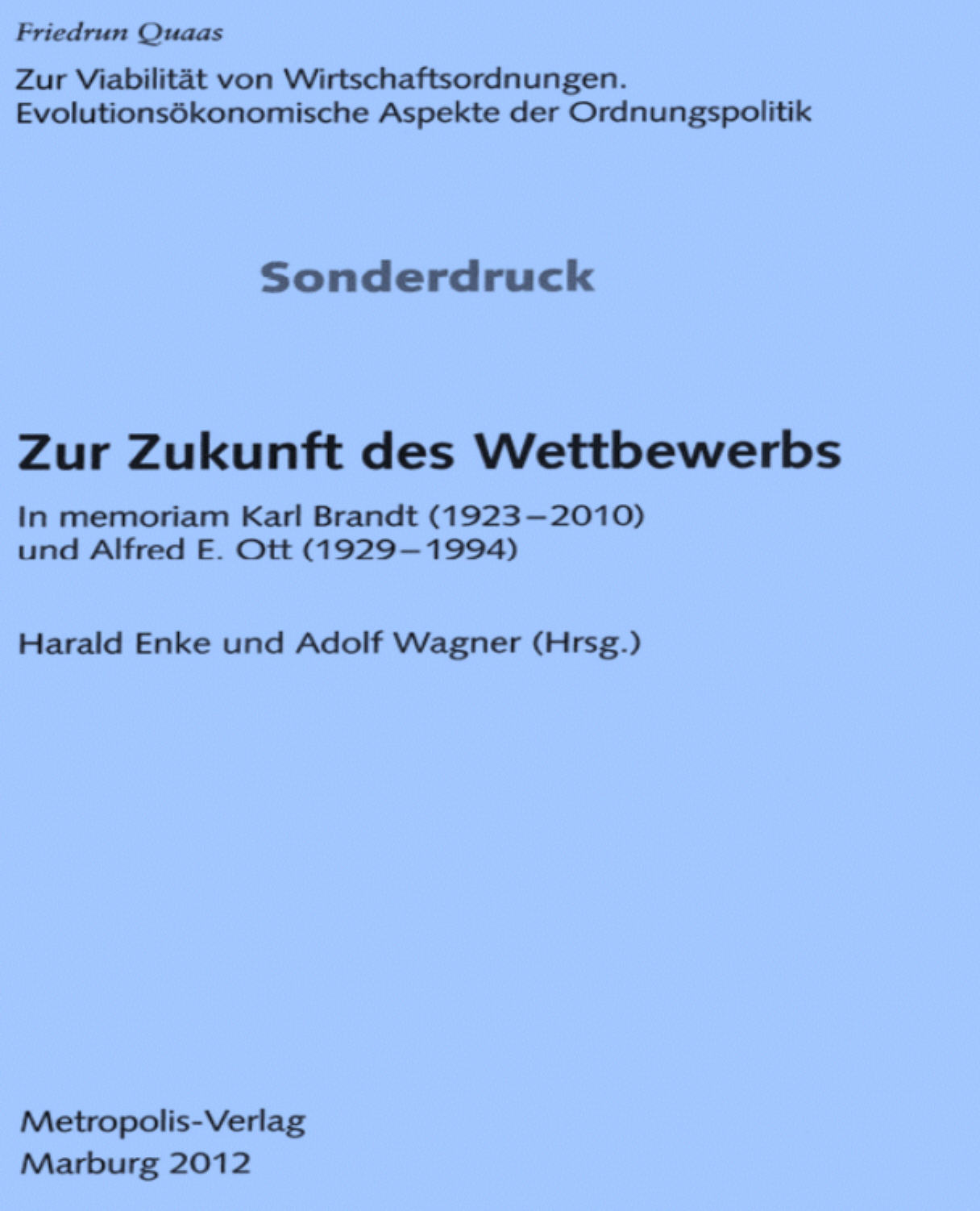
|
|
Ziel evolutorischer Ordnungstheorie ist es, bei Anerkennung des permanenten Wandels von gesellschaftlichen
Ordnungen, Bedingungen ihrer Viabilität herauszuarbeiten. Der Beitrag geht der Frage nach, ob dieses evolutorische
Element in der Ordnungstheorie der Freiburger Schule bereits enthalten ist. Am Beispiel der Ansätze von
Walter Eucken und Friedrich A. von Hayek wird gezeigt, wie die immanent normative Perspektive der Ordnungsökonomik
die evolutorische Botschaft beider Theoretiker beeinflusst hat: die Vorzugswürdigkeit der marktwirtschaftlichen
Ordnung rechtfertigt ihre ordnungspolitische Gestaltung zum Zwecke ihrer Erhaltung.
Diese krypto-normative Dimension der Ordnungsökonomik muss den wissenschaftlichen Zugang zur Problematik nicht
verhindern, erfordert jedoch einen deliberativen Ansatz der Behandlung verschiedener ordnungspolitischer Konzepte.
Verlag
|
|
Bubbles, Schocks und Asymmetrien. Ansätze zu einer Krisenökonomik
|

|
|
Bankenpleiten, Finanzmarktturbulenzen, dramatische Haushaltsdefizite, globale Asymmetrien
die Krise war 2008, 2009 und vielleicht noch 2010 allgegenwärtig und ein thematischer Dauerbrenner
in den Medien und Fachzeitschriften. Allerdings bieten die üblichen Medienformate häufig wenig Raum dafür,
und Fachartikel sind zu spezifisch, um einen ganzheitlichen Blick zu ermöglichen. Die Autoren, in der
Mehrheit Mitglieder des Leipziger Forschungsseminars Politik und Wirtschaft, verorten das Phänomen
der Krise und ihrer Formen in einem Raum, der theoretische, empirische, wirtschaftshistorische und
ideengeschichtliche Perspektiven eröffnet. Müssen bislang als gesichert geltende Erkenntnisse verworfen
werden? Oder hat die ökonomische Theorie umfassend versagt? Kann man aus der Geschichte der Krisen
und ihrer theoretischen Reflexion etwas lernen? Lassen sich die beiden großen Weltwirtschaftskrisen
sinnvoll vergleichen? Wie kann man das Entstehen von Spekulationsblasen theoretisch adäquat und empirisch
rechtzeitig erfassen? Das sind nur einige der aufgeworfenen Fragen, zu denen Antworten gesucht und
angeboten werden.
Verlag
|
|
Gero Thalemann: Die Soziale Marktwirtschaft der Bundesrepublik Deutschland - ein realisiertes Konzept?
|
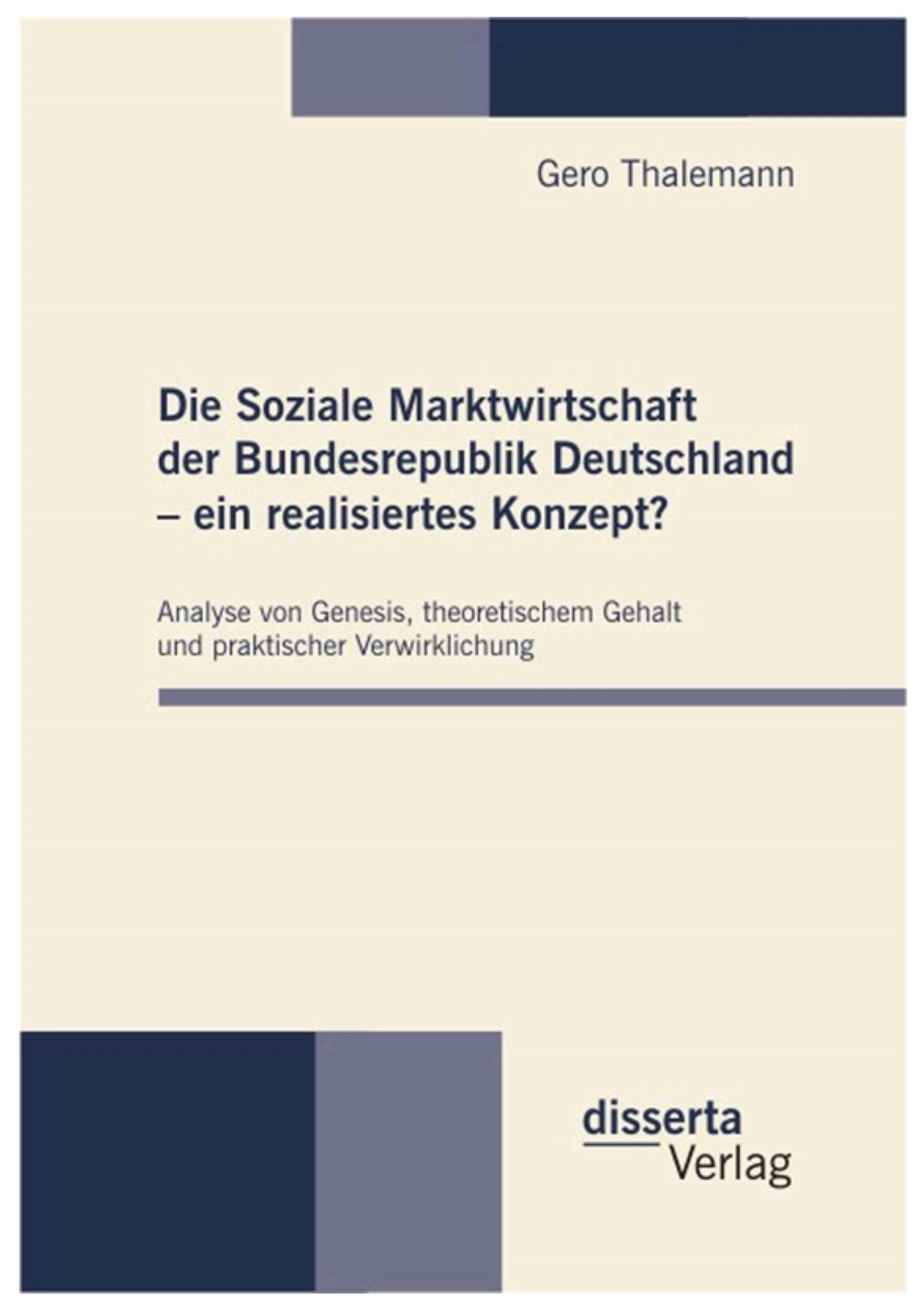
|
|
Das Werk befasst sich mit der Realisierung des Konzeptes der Sozialen Marktwirtschaft in der Bundesrepublik
Deutschland. Insbesondere soll geklärt werden, inwiefern Anspruch und Wirklichkeit voneinander abweichen.
Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, wird zuerst die Genesis, der Inhalt und somit auch der Anspruch
der Sozialen Marktwirtschaft erarbeitet. Es erfolgt eine Analyse ihres Begriffs, ihres Konzeptes, ihrer
Begründer und ihrer Prinzipien sowie eine Betrachtung der Hintergründe, welche zu dieser Wirtschaftsordnung
führten. Weiterhin werden die Grundwerte Freiheit und Soziales näher erläutert. Im Anschluss daran wird der
angesprochene Aspekt der Verwirklichung in der Praxis überprüft. Das dazu verwendete Mittel ist eine empirische
Analyse. Untersucht werden sowohl komplexe Kennzahlen und Indizes als auch Einzelindikatoren. Dabei werden
zwei Gesichtspunkte besonders berücksichtigt. Zum einen wird bei dieser Analyse eine möglichst breite Datenbasis
verwendet, um Universalität und Gültigkeit der gewonnenen Ergebnisse zu gewährleisten. Zum zweiten ist es
notwendig, alle Indikatoren über eine lange Zeit zu betrachten. Diese erstreckt sich, soweit dies möglich ist,
von 1950 bis heute und erfasst somit den Zeitraum des Bestehens der Sozialen Marktwirtschaft in der
Bundesrepublik Deutschland. Neben dem Umfang und der Dauer der Indikatorenbereitstellung wird weiterhin
erörtert, welche Kennzahlen einen sinnvollen Beitrag zur Klärung der Forschungsfrage leisten können.
Dies sind zum einen Kennzahlen zur Realisierung der Grundwerte der Sozialen Marktwirtschaft und zum anderen
Daten, welche die Verwirklichung fundamentaler Ziele prüfen. Insbesondere wurden also ihre Grundwerte
Freiheit und Soziales als auch das Leistungsziel und das Ziel der Wohlstands- beziehungsweise Wohlfahrtsgenerierung
untersucht.
Verlag
|